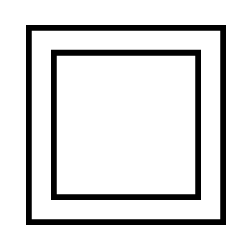This is an old revision of the document!
Table of Contents
Vom technischen Labor zum Studio Classroom
Ein Praxisbericht aus dem Creative Technologies Lab (E–015, FH Münster)
Der Anspruch an zeitgemäße Hochschullehre verändert sich: Studierende erwarten nicht nur Wissensvermittlung, sondern Räume für aktives, kollaboratives und kreatives Lernen. Besonders in technisch geprägten Studiengängen entsteht der Bedarf, klassische Laborräume neu zu denken. Der Studio Classroom ist ein solches Raumkonzept – offen, flexibel, interdisziplinär. Dieser Artikel dokumentiert, wie wir am Fachbereich ETI der FH Münster den Raum E–015 in ein Studio-Classroom-Umfeld transformiert haben – und welche Erfahrungen dabei gemacht wurden.
Der Raum wird regelmäßig für projektbasierte Lehrveranstaltungen genutzt. Studierende aus Informatik, Elektrotechnik und Design arbeiten hier gemeinsam an interaktiven Prototypen und Medieninstallationen. Der Raum unterstützt damit eine Lernkultur, die sich an realen Entwicklungsprozessen orientiert.
Inspiration und Anlass
Über zwei Videos des College of Architecture, Art and Design (CAAD) der American University of Sharjah bin ich eher zufällig gestolpert. Sie waren Anlass, meine eigenen Erfahrungen mit der Umgestaltung des Raums E–015 zu reflektieren und aufzuschreiben. Beide Videos zeigen, wie Lehrende dort Studio-basiertes Lernen praktizieren – ein Ansatz, der auch im technischen Kontext viele Parallelen erkennen lässt.
- Video 1: vimeo
Das Studio wird als zentrale Lernumgebung vorgestellt. Studierende lernen dort aktiv, experimentell und praxisorientiert. Lehrende begleiten, fördern Neugier und Selbstentfaltung. Die Atmosphäre ist offen und motivierend; Fehler gelten als Teil des Lernprozesses.
Die zentrale Idee dieser Ansätze, das der Raum selbst zum aktiven Teil des Lernens wird, spiegelt sich auch in unserem Projekt wider. Der Unterschied: In E–015 entstand der Wandel nicht durch große Investitionen oder institutionelle Programme, sondern durch pragmatische Entscheidungen, Eigeninitiative und die Wiederverwendung vorhandener Ressourcen.
Umsetzung in Raum E–015: Technik trifft Atelier
Low-Budget-Transformation und Wiederverwendung
Wie lässt sich ein Raum neu denken, ohne ein großes Budget? Wie schafft man Offenheit und Flexibilität, wenn vorhandene Ausstattung wenig inspirierend ist? Diese Fragen standen im Mittelpunkt des Umbaus von E–015. Das Projekt war kein großes Investitionsvorhaben, sondern ein Prozess des schrittweisen Gestaltens – mit begrenzten Mitteln, aber klarer Vision.
 Das verfügbare Budget belief sich auf rund 5.500 Euro aus dem Laborbudget von Prof. Felix Beck – verwendet für Materialien, Werkzeuge und wenige technische Geräte, die das kreative Arbeiten unterstützen und weiteren 2500 Euro für die Ausstattung zweier Lötarbeitsplätze finanziert durch den Fachbereich ETI 2). Der größte Teil der Ausstattung entstand aus bereits Vorhandenem. Insgesamt 15 ausrangierte Monitore aus dem Kollegium wurden integriert, ein alter 3D-Drucker wieder funktionsfähig gemacht. Labornetzteile, Platinen-Mikroskop stammen aus Laboren, die diese nicht mehr brauchten. Anstatt neue Möbel anzuschaffen, kamen 25 stapelbare Stühle aus einem anderen Fachbereich zum Einsatz – ursprünglich zum Entsorgen vorgesehen, nun Teil eines lebendigen Raumes. Alte Laborschränke, ehemals grau und sperrig, erhielten neue Holzplatten und wurden zu funktionalen Steh- und Arbeitstischen umgestaltet. Zwei Kaffeemaschinen und ein Wasserkocher entstammen privaten Spenden. Neu angeschafft wurden u.a. zwei bewegliche aufstellbare Whiteboards.
Das verfügbare Budget belief sich auf rund 5.500 Euro aus dem Laborbudget von Prof. Felix Beck – verwendet für Materialien, Werkzeuge und wenige technische Geräte, die das kreative Arbeiten unterstützen und weiteren 2500 Euro für die Ausstattung zweier Lötarbeitsplätze finanziert durch den Fachbereich ETI 2). Der größte Teil der Ausstattung entstand aus bereits Vorhandenem. Insgesamt 15 ausrangierte Monitore aus dem Kollegium wurden integriert, ein alter 3D-Drucker wieder funktionsfähig gemacht. Labornetzteile, Platinen-Mikroskop stammen aus Laboren, die diese nicht mehr brauchten. Anstatt neue Möbel anzuschaffen, kamen 25 stapelbare Stühle aus einem anderen Fachbereich zum Einsatz – ursprünglich zum Entsorgen vorgesehen, nun Teil eines lebendigen Raumes. Alte Laborschränke, ehemals grau und sperrig, erhielten neue Holzplatten und wurden zu funktionalen Steh- und Arbeitstischen umgestaltet. Zwei Kaffeemaschinen und ein Wasserkocher entstammen privaten Spenden. Neu angeschafft wurden u.a. zwei bewegliche aufstellbare Whiteboards.
Der bewusste Verzicht auf Designmöbel und High-End-Ausstattung fördert die Identifikation der Studierenden mit dem Raum. Sie erleben, dass Gestalten auch mit einfachen Mitteln möglich ist – ein Prinzip, das sich in den Projektmethoden des Studiengangs widerspiegelt.
Diese kleinen Eingriffe hatten große Wirkung: Der Raum wirkt heute offener, wärmer und deutlich einladender. Die Atmosphäre erinnert an eine Werkstatt, in der alles in Bewegung ist. Nichts ist zu schade, um wiederverwendet zu werden; nichts ist zu festgelegt, um nicht verändert werden zu können. Die Gestaltung folgt dem Prinzip: “Use what you have – and make it work.”
Alle Werkzeuge, Kabel, Adapter, Netzteile, Maschinen des Labors werden sichtbar mit neon-gelbem Nagellack und/oder neon-gelbem Klebeband markiert. Dieser visuelle Marker zeugt davon welche Hardware ins Labor gehört und, falls doch einmal etwas ausgeliehen werden sollte, alles sehr schnell identifiziert und wieder zurück gebracht werden kann. Mit schwarzem Marker beschriftetes neon-gelbes Klebeband wird benutzt, um Schränke zu laben und anzuzeigen was darin zu finden ist. Diese wieder entfernbaren und neu zu platzierenden Labels zeugen von Flexibilität: Man kann schnell umräumen, Platz schaffen, neue Ordnung organisieren. (Labelmaschinen hingegen sprechen von Bürokratie. Sie brauchen Batterien. Sie brauchen jemanden, der/die sie bedienen kann. Sie liegen in einer Schublade, die man nicht wiederfindet. Sie funktionieren nicht!)
Sichtbare Prozesse und spontane Dokumentation
 Leere Wandflächen, Türen und Glasscheiben dienen als temporäre Notizflächen. Mit Whiteboardmarkern beschriebene Oberflächen werden nicht sofort gereinigt, sondern bleiben sichtbar – als Spuren von Prozessen, als Zeichen aktiver Nutzung. Diese visuelle Offenheit verändert den Charakter des Raums: Er dokumentiert, dass hier gearbeitet, gedacht und gestaltet wird. Er erzählt Geschichten von Versuchen, Korrekturen und neuen Ansätzen. Oder, wie Studierende es oft sagen: „Hier passiert etwas.“
Leere Wandflächen, Türen und Glasscheiben dienen als temporäre Notizflächen. Mit Whiteboardmarkern beschriebene Oberflächen werden nicht sofort gereinigt, sondern bleiben sichtbar – als Spuren von Prozessen, als Zeichen aktiver Nutzung. Diese visuelle Offenheit verändert den Charakter des Raums: Er dokumentiert, dass hier gearbeitet, gedacht und gestaltet wird. Er erzählt Geschichten von Versuchen, Korrekturen und neuen Ansätzen. Oder, wie Studierende es oft sagen: „Hier passiert etwas.“
Sichtbarkeit schafft Verantwortlichkeit, stärkt Gruppenidentität und motiviert zur Weiterarbeit.
Stickerwand: Archiv der Begegnungen
 Gleich beim Betreten des Raums fällt die Holzfläche am Eingang ins Auge, die mit einer dichten Schicht aus Aufklebern bedeckt ist. Diese Sticker stammen von verschiedenen Laboren, Maker Spaces und Kreativzentren weltweit. Viele davon sind Erinnerungen an frühere Besuche, Austauschprojekte oder internationale Kooperationen, andere wurden einfach aus Spaß oder Neugier angebracht. Die überlagerte, bunte Struktur ist ein lebendiges, visuelles Archiv der Begegnungen, die das Creative Technologies Lab geprägt haben. Die Fläche wirkt spontan und ungeordnet, strahlt aber genau dadurch Offenheit und Zugänglichkeit aus.
Gleich beim Betreten des Raums fällt die Holzfläche am Eingang ins Auge, die mit einer dichten Schicht aus Aufklebern bedeckt ist. Diese Sticker stammen von verschiedenen Laboren, Maker Spaces und Kreativzentren weltweit. Viele davon sind Erinnerungen an frühere Besuche, Austauschprojekte oder internationale Kooperationen, andere wurden einfach aus Spaß oder Neugier angebracht. Die überlagerte, bunte Struktur ist ein lebendiges, visuelles Archiv der Begegnungen, die das Creative Technologies Lab geprägt haben. Die Fläche wirkt spontan und ungeordnet, strahlt aber genau dadurch Offenheit und Zugänglichkeit aus.
Diese visuellen Schichten erzeugen Zugehörigkeit. Sie machen deutlich, dass der Raum von vielen genutzt, verändert und weitergeführt wird – eine räumliche Form von „kollektivem Gedächtnis“.
Pinnwand: Prozess, Austausch und Wandel
 Ein weiteres prägendes Element des Raums ist die große Pinnwand, die an der Längsseite des Studios installiert wurde. Sie besteht aus einfachen Styrodurplatten aus dem Baumarkt, die mit einem robusten, preiswerten Markisenstoff überzogen wurden. Diese Kombination ist leicht, kostengünstig und zugleich funktional – Nadeln und Klammern halten zuverlässig, und die textile Oberfläche verleiht dem Raum eine nicht-technische Anmutung. Die Pinnwand ist niemals „fertig“ oder dekorativ gemeint, sondern ein sich ständig wandelndes Display: Hier hängen aktuelle Visualisierungen von Projekten, Flyer zu laufenden Veranstaltungen, Plakate vergangener Ausstellungen oder spontane Notizen aus Seminaren. Die Inhalte wechseln regelmäßig und spiegeln das dynamische Leben im Studio wider. Sie folgt denselben Prinzipien wie der Rest des Raums – Offenheit, Prozesshaftigkeit und die Bereitschaft, Vergangenes sichtbar zu lassen, um Neues anzuregen.
Ein weiteres prägendes Element des Raums ist die große Pinnwand, die an der Längsseite des Studios installiert wurde. Sie besteht aus einfachen Styrodurplatten aus dem Baumarkt, die mit einem robusten, preiswerten Markisenstoff überzogen wurden. Diese Kombination ist leicht, kostengünstig und zugleich funktional – Nadeln und Klammern halten zuverlässig, und die textile Oberfläche verleiht dem Raum eine nicht-technische Anmutung. Die Pinnwand ist niemals „fertig“ oder dekorativ gemeint, sondern ein sich ständig wandelndes Display: Hier hängen aktuelle Visualisierungen von Projekten, Flyer zu laufenden Veranstaltungen, Plakate vergangener Ausstellungen oder spontane Notizen aus Seminaren. Die Inhalte wechseln regelmäßig und spiegeln das dynamische Leben im Studio wider. Sie folgt denselben Prinzipien wie der Rest des Raums – Offenheit, Prozesshaftigkeit und die Bereitschaft, Vergangenes sichtbar zu lassen, um Neues anzuregen.
Auditiver Layer
Wie die Pinnwand den visuellen Austausch im Raum unterstützt, trägt auch der auditive Layer zur Atmosphäre und Funktionalität des Studios bei. Die textile Oberfläche der Pinnwand verbessert zugleich die Raumakustik – sie reduziert Reflexionen und sorgt dafür, dass Gespräche und Präsentationen klarer wahrgenommen werden. So entsteht nicht nur visuell, sondern auch akustisch eine Umgebung, die Konzentration und Kommunikation fördert.
Direkt am Eingang befindet sich ein horizontal ausgerichteter Bildschirm, über den Studierende in ruhigeren Phasen – etwa während Pausen oder Arbeitszeiten zwischen Kursen – Audioinhalte über einen Browser abspielen können. Bisher zeigte sich, dass diese Nutzung diszipliniert und kontextsensibel erfolgt: Es gibt keine störenden oder lauten Abläufe, vielmehr wird das Angebot als Ergänzung zum offenen, gemeinschaftlichen Charakter des Raums verstanden.
Beim Hochfahren des im Raum installierten Mac Mini startet automatisch ein Audio-Plugin, das eine generative Audio-Scape erzeugt. Dieses System mischt leise, atmosphärische Klänge wie Regengeräusche, Wind, entfernte Schritte oder das Murmeln eines Cafés. Die Klanglandschaft ist dezent gehalten und soll weder ablenken noch dominieren, sondern den Raum subtil beleben. Sie wirkt dabei ähnlich wie ein akustischer Hintergrund in offenen Ateliers oder Studios: Sie überdeckt störende Nebengeräusche, schafft ein Gefühl von Präsenz und Aktivität und unterstützt konzentriertes Arbeiten. Der Audio-Layer wird so zu einem weiteren Baustein der räumlichen Gestaltung – er macht die kreative Dynamik des Studio Classrooms nicht nur sichtbar, sondern auch hörbar erfahrbar.
Für größere Präsentationen oder Projektvorstellungen sind im Raum verkabelte Lautsprecher installiert, die einfach über Screen-/Audioshare eingebunden werden können. So lassen sich Ton, Musik oder Videos problemlos in Lehre, Projektdokumentation oder Ausstellungssituationen integrieren. Der auditive Layer erweitert damit die multisensorische Qualität des Studio Classrooms – er macht den Raum nicht nur sicht-, sondern auch hörbar lebendig.
Gerahmte Arbeiten als Lehrwerkzeug
 Eine weitere Besonderheit sind die gerahmten Bilder, die über mehrere Wände verteilt hängen. Die Inhalte variieren und können Semesterbezug haben, dokumentarisch sein, oder auch etwas mit den MINDT-Fächern zu tun haben, wie bspw Illustrationen der NASA, die versucht Bwerber*innen für eine fiktive Marsmission zu gewinnen. Unterschiedliche Formate bilden Cluster, die sich aus einzelnen Arbeiten zu thematischen Gruppen zusammensetzen. Diese Sammlung wächst kontinuierlich und ist zugleich Teil der Lehre: In bestimmten Kursen erhalten Studierende die Aufgabe, sich einen der verschieden großen Rahmen auszusuchen, ein bestehendes Layout auf dieses Format anzupassen und ihr eigenes Projekt darin zu dokumentieren. So werden technische Experimente, Prozessfotografien, Visualisierungen oder Textfragmente in ein kuratiertes Format überführt. Die Wände dienen somit nicht nur der Präsentation, sondern werden zu didaktischen Werkzeugen – Orte der Reflexion, der Erinnerung und des Austauschs.
Eine weitere Besonderheit sind die gerahmten Bilder, die über mehrere Wände verteilt hängen. Die Inhalte variieren und können Semesterbezug haben, dokumentarisch sein, oder auch etwas mit den MINDT-Fächern zu tun haben, wie bspw Illustrationen der NASA, die versucht Bwerber*innen für eine fiktive Marsmission zu gewinnen. Unterschiedliche Formate bilden Cluster, die sich aus einzelnen Arbeiten zu thematischen Gruppen zusammensetzen. Diese Sammlung wächst kontinuierlich und ist zugleich Teil der Lehre: In bestimmten Kursen erhalten Studierende die Aufgabe, sich einen der verschieden großen Rahmen auszusuchen, ein bestehendes Layout auf dieses Format anzupassen und ihr eigenes Projekt darin zu dokumentieren. So werden technische Experimente, Prozessfotografien, Visualisierungen oder Textfragmente in ein kuratiertes Format überführt. Die Wände dienen somit nicht nur der Präsentation, sondern werden zu didaktischen Werkzeugen – Orte der Reflexion, der Erinnerung und des Austauschs.
Fleischerkisten: Farbe, Funktion und Flexibilität
 Ein zentrales und zugleich pragmatisches Element des Studio Classrooms sind die bunten Fleischerkisten. Diese robusten Kunststoffboxen mit den Maßen 70 × 50 × 20 cm dienen als vielseitige Ordnungssysteme, Arbeitsmodule und Gestaltungselemente zugleich. Ein Teil der Kisten ist in einem offenen Regal integriert, das gleichzeitig als Raumteiler fungiert. Auf der Frontseite wird mit Whiteboard-Markern oder Kreideschrift vermerkt, was sich in den einzelnen Kisten befindet – von Werkzeugen und Elektronikkomponenten bis hin zu Materialien oder Projektteilen. So bleibt der Raum transparent und funktional, ohne in sterile Ordnung zu verfallen.
Ein zentrales und zugleich pragmatisches Element des Studio Classrooms sind die bunten Fleischerkisten. Diese robusten Kunststoffboxen mit den Maßen 70 × 50 × 20 cm dienen als vielseitige Ordnungssysteme, Arbeitsmodule und Gestaltungselemente zugleich. Ein Teil der Kisten ist in einem offenen Regal integriert, das gleichzeitig als Raumteiler fungiert. Auf der Frontseite wird mit Whiteboard-Markern oder Kreideschrift vermerkt, was sich in den einzelnen Kisten befindet – von Werkzeugen und Elektronikkomponenten bis hin zu Materialien oder Projektteilen. So bleibt der Raum transparent und funktional, ohne in sterile Ordnung zu verfallen.
Andere Kisten werden übereinandergestapelt und mit Holzplatten abgedeckt, sodass daraus stabile, fahrbare Stelen entstehen. Diese können flexibel im Raum positioniert werden und dienen bei Bedarf als Präsentationspodeste, Sprecherpulte oder Ablageflächen für Exponate und Modelle. Durch ihre leuchtenden Farben tragen die Kisten zu einer lebendigen, unkonventionellen Atmosphäre bei, die den kreativen Charakter des Raums unterstreicht.
Darüber hinaus erfüllen sie einen ganz praktischen Zweck: Studierende, die ihre Projekte nicht mit nach Hause nehmen können, lagern ihre Arbeiten, Bauteile oder laufenden Experimente in diesen Kisten ein. Jede Kiste ist somit Teil eines offenen Systems, das Ordnung und Flexibilität miteinander verbindet – funktional, farbenfroh und durchdacht.
Das modulare System der Kisten lehrt Studierende implizit Prinzipien von Ordnung, Nachhaltigkeit und Selbstorganisation – zentrale Fähigkeiten im prototypischen Arbeiten.
Ein lebendiges Archiv des Lernens
Im heutigen Zustand zeigt E–015 eine Vielfalt an Projekten und Prototypen – von sensorbasierten Installationen über Materialstudien bis hin zu interaktiven Interfaces. Studierende und Lehrende nutzen den Raum nicht nur als Werkstatt, sondern auch als Ausstellungsfläche. Entwürfe und Experimente werden nicht weggeräumt, sondern bleiben sichtbar. So entsteht ein „lebendiges Archiv“ des Lernens, das ständig wächst und sich verändert.
Dieses Prinzip lässt sich gut mit dem Konzept des “Composting Prototypes” vergleichen: Frühere oder unvollständige Arbeiten werden nicht entsorgt, sondern dienen als Nährboden für neue Ideen. Durch diese Praxis wird Lernen sichtbar – als fortlaufender, iterativer Prozess, der über Semestergrenzen hinaus Wirkung entfaltet.
Zentrale Elemente des Raums
- Flexible Möblierung: Fahrbare Tische, stapelbare Stühle und offene Flächen erlauben spontane Konfigurationen für Gruppenarbeit, Präsentationen oder Werkstattbetrieb.
- Technische Infrastruktur: 3D-Drucker, Laser-Cutter (hoffentlich bald!), Handwerkzeuge, Microcontroller, Sensoren und Physical-Computing-Kits bilden die Grundlage für kreatives Prototyping.
- Visualisierungsflächen: Whiteboards, Displays und mobile Präsentationssysteme fördern Austausch, Reflexion und Sichtbarkeit von Prozessen.
- Didaktische Offenheit: Interdisziplinäre Teams, iterative Projektarbeit und eine Lernkultur, die Fehler als produktive Schritte versteht.
Ziel ist ein Raum, der sich den Lehrinhalten anpasst – nicht umgekehrt. Er dient zugleich als Werkstatt, Atelier, Labor, Ausstellungsfläche und Ort des Dialogs. Projekte, die hier entstehen, verbinden technische Präzision mit gestalterischem Denken – von interaktiven Exponaten über urbane Interfaces bis zu spekulativen Designkonzepten mit gesellschaftlicher Relevanz.
Leitfragen, die der Raum beantwortet
- Wie kann ein Raum Kreativität und technische Präzision verbinden?
- Wie lassen sich Informatik, Elektrotechnik und Design in einem gemeinsamen Erfahrungsraum verknüpfen?
- Wie fördern wir Eigenverantwortung, Kollaboration und reflektiertes Scheitern als produktiven Schritt?
- Wie bleibt Lehre anpassungsfähig, ohne an Struktur zu verlieren?
Rückschritte und Behinderungen
Wo Neues entsteht, entstehen auch Reibungen. Die Transformation von E–015 war nicht nur ein gestalterischer, sondern auch ein kultureller Prozess – und wie bei vielen Veränderungsprojekten zeigte sich, dass Innovation in bestehenden Strukturen oft auf Skepsis stößt. Neues erzeugt Unbehagen, insbesondere bei Personen, die institutionell Verantwortung tragen. Gerade in Verwaltungsbereichen entsteht schnell das Gefühl von Unsicherheit, vor allem im Hinblick auf Sicherheitsfragen und Haftung. Das Motto „Wir haben das immer schon so gemacht“ dient dann oft als Schutzschild gegen Veränderung.
Unter dem Deckmantel sogenannter „Best Practices“ werden kreative Formate, offene Experimente oder temporäre Prototypen nicht selten in Frage gestellt oder zerredet. Der Wunsch nach Kontrolle steht dabei im Widerspruch zu einer Lernkultur, die auf Eigenverantwortung, Vertrauen und Ausprobieren basiert. Häufig liegt der Widerstand weniger in der Ablehnung der Idee selbst, sondern in der Angst vor zusätzlicher Arbeit oder vor dem Risiko, Fehler zu machen. Aus dieser Haltung erwächst eine gewisse Abneigung gegenüber Projekten, die vom Gewohnten abweichen – auch wenn sie letztlich im Sinne der Lehre und Studierendenkultur wirken.
 Manche Rückschritte zeigen sich auch im Kleinen, etwa in bürokratischen Routinen, die gestalterische Sorgfalt ignorieren. So werden Geräte regelmäßig auf Funktion geprüft und mit Prüfaufklebern versehen – ein an sich notwendiger Vorgang. Doch die Durchführung zeugt bisweilen von mangelndem ästhetischem Bewusstsein: Aufkleber werden gut sichtbar auf Frontflächen platziert, etwa auf die glänzende Oberfläche einer Kaffeemaschine – an genau die Stelle, die zwangsläufig schnell verschmutzt. Die Frage, warum ein solcher Aufkleber nicht schlicht auf die Rückseite geklebt werden kann, bleibt offen. Solche Details mögen banal erscheinen, doch sie verdeutlichen, wie bürokratische Logik und gestalterische Sensibilität oft unverbunden nebeneinander existieren.
Manche Rückschritte zeigen sich auch im Kleinen, etwa in bürokratischen Routinen, die gestalterische Sorgfalt ignorieren. So werden Geräte regelmäßig auf Funktion geprüft und mit Prüfaufklebern versehen – ein an sich notwendiger Vorgang. Doch die Durchführung zeugt bisweilen von mangelndem ästhetischem Bewusstsein: Aufkleber werden gut sichtbar auf Frontflächen platziert, etwa auf die glänzende Oberfläche einer Kaffeemaschine – an genau die Stelle, die zwangsläufig schnell verschmutzt. Die Frage, warum ein solcher Aufkleber nicht schlicht auf die Rückseite geklebt werden kann, bleibt offen. Solche Details mögen banal erscheinen, doch sie verdeutlichen, wie bürokratische Logik und gestalterische Sensibilität oft unverbunden nebeneinander existieren.
Diese Beobachtungen zeigen, dass räumliche Innovation immer auch institutionelle Auseinandersetzung bedeutet. Der Studio Classroom ist nicht nur ein Ort der Lehre, sondern ein Symbol dafür, dass Hochschulen lernen müssen, Risiko und Verantwortung produktiv zu balancieren, wenn sie kreative Entwicklung wirklich zulassen wollen.
Sicherheit und Zugänglichkeit
Sicherheitsaspekte sind ein zentraler Bestandteil jeder Laborumgebung – und selbstverständlich müssen gefährliche Maschinen oder Geräte entsprechend gesichert werden. Manche Geräte werden deshalb in einzelnen Laboren weggeschlossen, was angesichts möglicher Risiken völlig nachvollziehbar ist: Ein falscher Handgriff an einer Hochspannungsquelle oder an einer offenen Maschine kann schwerwiegende, im Extremfall tödliche Folgen haben. Doch aus dieser berechtigten Vorsicht entwickelt sich mitunter eine übermäßige Sicherheitslogik, die Innovation und Eigenverantwortung behindert.
Es erscheint paradox, wenn ein gesamter Raum oder Maker Space unzugänglich wird, nur weil irgendwo in einer Ecke ein Gerät steht, das seit Jahren ungenutzt bleibt. Statt Lernenden pauschal den Zugang zu verwehren, sollte die Sicherheit situationsbezogen und differenziert gedacht werden. Ein einfaches Beispiel: Ein Gerät, das potenziell gefährlich, aber selten im Einsatz ist, kann durch das Verschließen des Netzsteckers mit einem Sicherheitsschloss effektiv deaktiviert werden. So bleibt der Raum grundsätzlich offen, während das Risiko kontrollierbar bleibt. Für besondere Lehrveranstaltungen oder Demonstrationen kann das Gerät gezielt unter Aufsicht in Betrieb genommen werden – sicher, nachvollziehbar und pädagogisch sinnvoll. Eine Opendoor-Policy, die Studierenden eigenständiges Arbeiten und exploratives Lernen ermöglicht, sollte durch solche Einzelmaßnahmen nicht eingeschränkt werden. Offenheit und Sicherheit müssen keine Gegensätze sein – sie erfordern lediglich Vertrauen, Verantwortung und pragmische Lösungen, die den pädagogischen Auftrag nicht untergraben, sondern stützen.
Empfehlungen für Kolleg*innen
Die Erfahrungen mit E–015 zeigen, dass der Wandel vom klassischen Labor zum lebendigen Studio Classroom kein Großprojekt sein muss. Entscheidend sind Haltung, Offenheit und die Bereitschaft, vorhandene Mittel kreativ zu nutzen. Die folgenden Punkte fassen zentrale Prinzipien und praktische Beispiele zusammen, die sich leicht auf andere Lehrkontexte übertragen lassen:
- Den Raum als Lernwerkzeug begreifen
Ein Studio Classroom ist mehr als ein Ort – er ist ein aktiver Teil des Lehrprozesses.
- Räume müssen sich an Lehrinhalte anpassen – nicht umgekehrt.
- Beispiele: Fahrbare Arbeitstische, beschreibbare Flächen, flexible Zonen für Gruppenarbeit.
- Ergebnis: Lernende übernehmen Verantwortung, Lehrende können situativ reagieren.
- Bestehendes kreativ nutzen
Transformation beginnt mit dem, was schon da ist.
- Beispiele: 25 ausrangierte Stühle, umgebaute Laborschränke mit Holzplatten, wiederbelebter 3D-Drucker, Monitore aus dem Kollegium.
- Ergänzend: Styrodur-Pinnwand mit Markisenstoff, bunte Fleischerkisten als Regalsysteme oder mobile Präsentationsstelen.
- Effekt: Geringe Kosten, hoher Identifikationswert – der Raum wird durch Eigenleistung geprägt.
- Lernkultur gestalten
Sichtbarkeit, Prozesshaftigkeit und Beteiligung machen Lernen erfahrbar.
- Beispiele: Nicht gelöschte Whiteboard-Notizen, Stickerwand als visuelles Archiv, Rahmen-Cluster für studentische Arbeiten.
- Prinzip: Der Raum dokumentiert Entwicklung und erzeugt Gemeinschaft – „Hier passiert etwas“.
- Technische Verlässlichkeit und Improvisationsfreiheit sichern
Stabile, sofort verfügbare Infrastruktur ist die Voraussetzung für Spontanität.
- Beispiele: Funktionsfähige Projektoren, Displays und verkabelte Lautsprecher; offenes Screen-/Audiosharing.
- Ziel: Lehrende und Studierende können jederzeit präsentieren, zeigen, austauschen – ohne technische Barrieren.
- Atmosphäre schaffen – multisensorisch denken
Ein Studio Classroom spricht alle Sinne an und fördert Konzentration durch eine angenehme Raumwirkung.
- Beispiele: Textiloberflächen der Pinnwand zur Verbesserung der Akustik; leise Audio-Scapes mit Regen- oder Cafégeräuschen; subtile Klangkulisse als Teil des Raumerlebnisses.
- Wirkung: Der Raum bleibt ruhig, lebendig und kreativ zugleich.
- Sicherheit und Zugänglichkeit ausbalancieren
Sicherheitsvorschriften sind notwendig, dürfen aber Offenheit und Lernfreiheit nicht ersticken.
- Beispiele: Geräte mit abschließbarem Netzstecker statt kompletter Raumsperrung; beaufsichtigte Nutzung in Sonderveranstaltungen.
- Ziel: Eine Opendoor-Policy bleibt erhalten, während Risiken kontrolliert werden – Sicherheit durch Verantwortung, nicht durch Abschottung.
- Rückschritte und Behinderungen ernst nehmen
Innovation stößt in gewachsenen Strukturen oft auf Skepsis und Bürokratie.
- Beispiele: Unsicherheiten in der Verwaltung, Widerstand gegen neue Formate, unreflektierte Anwendung von „Best Practices“, ästhetisch fragwürdige Prüfaufkleber mitten auf Geräten.
- Empfehlung: Gelassen bleiben, transparent kommunizieren und aufzeigen, dass Veränderung nicht Kontrollverlust, sondern Lernkultur bedeutet.
- Raum öffnen und sichtbar machen
Der Studio Classroom lebt von Transparenz, Austausch und öffentlicher Präsenz.
- Beispiele: Offene Projektpräsentationen, Ausstellungen im Raum, Kooperationen mit externen Partnern.
- Nutzen: Der Raum gewinnt Profil nach außen und stärkt die Community nach innen.
E–015 zeigt, dass nachhaltige Transformation aus Haltung entsteht – nicht aus Budgets. Räume verändern sich, wenn Lehrende und Studierende sie gemeinsam gestalten, ausprobieren und anpassen. Der Studio Classroom wird so zum Prototyp einer Lernumgebung, die Bewegung, Improvisation und Innovation selbstverständlich macht.
Fazit
Ein Studio Classroom sollte stets die experimentelle und praxisorientierte Lehre sichtbar und erlebbar machen. Der Raum selbst wird so zum Ausdruck einer Haltung: Er repräsentiert Offenheit, Neugier und den Mut, Dinge auszuprobieren. Damit Lehrende und Studierende diese Freiheit auch wirklich leben können, braucht es eine verlässliche technische Infrastruktur, die Flexibilität ermöglicht, ohne zusätzlichen Aufwand zu erzeugen. Projektoren und große Displays müssen jederzeit funktionieren – ohne komplizierte Einstellungen oder Kabelsuche. Jeder soll sich überall im Raum spontan anschließen können, um einen Prototyp, eine Präsentation oder ein Fundstück aus dem Internet zu zeigen. Diese Grundstabilität in der Technik schafft den nötigen Freiraum für Improvisation, spontane Lernmomente und gemeinsames Entdecken – und bildet die Basis dafür, dass ein Studio Classroom nicht nur ein Ort des Arbeitens, sondern auch des Denkens, Forschens und Experimentierens bleibt.
Der Ansatz lässt sich auf viele andere Lehrsituationen übertragen – überall dort, wo Lehre experimentell, interdisziplinär und projektorientiert gedacht wird.
Interessanterweise lassen sich die Ergebnisse des intuitiven Aufbaus von Raum E–015 im Nachhinein sehr gut mit der Theory of Space-Based Knowledge Management von Prof. Dr. Katja Thoring beschreiben.3) 4) Ohne dass diese Theorie zuvor bekannt war oder als Grundlage diente, spiegeln sich in der Gestaltung des Raums viele ihrer zentralen Prinzipien wider:
- Der Raum erfüllt in hohem Maße die Funktion eines Socialisation Space: Offene Flächen, flexible Sitzgruppen und informelle Arbeitszonen fördern Begegnung, Austausch und gemeinsames Lernen. Wissen entsteht hier im Dialog – durch spontane Gespräche, gemeinsame Improvisation und Beobachtung anderer.
- Gleichzeitig übernimmt E–015 Eigenschaften eines Codification Space. Die beschreibbaren Oberflächen, Whiteboards, Glaswände und Pinnflächen machen Denkprozesse sichtbar und dauerhaft zugänglich. Ideen, Skizzen und Notizen bleiben im Raum präsent und bilden ein wachsendes kollektives Gedächtnis.
- Darüber hinaus manifestiert sich Wissen im Lab als Artifact Space. Projekte, Modelle, Prototypen und Materialstudien sind physische Wissensspeicher, die über die Lehrveranstaltungen hinaus bestehen bleiben. Sie zeigen, dass Lernen und Forschen hier nicht nur abstrakt, sondern konkret und erfahrbar stattfindet.
Diese drei Dimensionen – soziale Interaktion, Dokumentation und Materialisierung – entstanden im Creative Technologies Lab nicht aus einer vorgegebenen Raumtheorie, sondern als Ergebnis praktischer Notwendigkeit, kontinuierlicher Nutzung und Beobachtung. Erst im Rückblick wird sichtbar, dass der Raum intuitiv jene Qualitäten verkörpert, die Thoring als Grundlage einer wissensfördernden Lernumgebung beschreibt.
Der Studio Classroom in E–015 ist heute ein lebendiger Beweis dafür, dass kreative Lernumgebungen nicht gekauft, sondern gestaltet werden. Er reagiert auf Menschen, Ideen und Prozesse – nicht umgekehrt. Lernen geschieht hier durch Machen, Teilen und Reflektieren. Der Raum bleibt im Wandel, genauso wie seine Nutzer*innen. Ein guter Lernraum ist nie fertig – er wächst mit den Ideen, die in ihm entstehen.