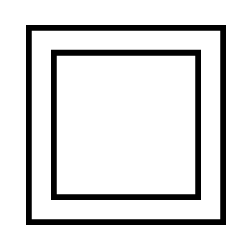This is an old revision of the document!
MINDT beschreibt eine Weiterentwicklung des bekannten MINT-Ansatzes, der für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik steht. Während MINT in den letzten zwei Jahrzehnten vor allem auf die Förderung technischer und analytischer Kompetenzen abzielte, wird MINDT als Erweiterung verstanden, die „Design“ als fünfte Dimension integriert. Diese Integration bedeutet nicht lediglich die Hinzufügung eines gestalterischen Faches, sondern markiert einen epistemischen Wandel im Verständnis von Bildung im 21. Jahrhundert. Sie rückt Kreativität, Sinnstiftung und gesellschaftliche Verantwortung in den Mittelpunkt einer Disziplinen übergreifenden Denkweise. Der Gedanke, natur- und ingenieurwissenschaftliche Ausbildung mit designorientierten Methoden und Denkweisen zu verknüpfen, folgt der Einsicht, dass komplexe Probleme heutiger Gesellschaften nicht durch disziplinär abgeschlossene Fachkompetenzen gelöst werden können. Vielmehr erfordern sie transdisziplinäre Perspektiven, die sowohl systemisch als auch human-zentriert agieren. In diesem Spannungsfeld entsteht MINDT als integratives Bildungsmodell, das Rationalität und Imagination, Analyse und Empathie, Funktionalität und Bedeutung miteinander verbindet.
Historisch lässt sich die Entstehung von MINDT auf die internationale STEAM-Bewegung zurückführen, die zu Beginn der 2010er Jahre von John Maeda am Rhode Island School of Design (RISD) geprägt wurde. STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics) sollte den engen STEM-Diskurs (Science, Technology, Engineering, Mathematics) um künstlerische und kreative Kompetenzen erweitern. Maeda argumentierte, dass die Innovationskraft der Zukunft nicht allein aus technologischer Exzellenz, sondern aus der Fähigkeit zur Integration von Kunst, Design und Wissenschaft entstehen werde. Seine Initiative fand international Resonanz, insbesondere in den Vereinigten Staaten, Südkorea und Großbritannien, und führte zur Entwicklung von Lehrprogrammen, die analytisches und ästhetisches Denken gleichberechtigt kombinierten. In Deutschland blieb die Rezeption zunächst verhalten, was mit der institutionellen Trennung von künstlerischen und technischen Bildungssystemen zusammenhängt. Erst in jüngerer Zeit wurde durch hochschulpolitische Programme, neue Studiengänge und die Forderung nach interdisziplinären Innovationskompetenzen ein Rahmen geschaffen, in dem die Verbindung von Design und Technik strukturell verankert werden kann.
Im deutschen Sprachraum wurde aus STEAM die Variante MINDT – ein Akronym, das das „A“ der Arts präzisiert und auf „Design“ fokussiert. Diese Verschiebung ist nicht semantischer, sondern erkenntnistheoretischer Natur. Design in MINDT steht nicht als Synonym für dekorative Gestaltung oder visuelle Formfindung, sondern als Methode des forschenden, iterativen und systemischen Denkens. Es beschreibt einen Zugang zur Welt, der zwischen analytischer Reduktion und erfahrungsbasierter Synthese vermittelt. Design wird hier als Prozess verstanden, in dem Wissen nicht nur angewendet, sondern erzeugt wird. Der Designer oder die Designerin wird zur forschenden Instanz, die Probleme nicht nur löst, sondern zunächst definiert, reframed und durch experimentelles Handeln transformiert. Dieser Perspektivwechsel verleiht MINDT eine besondere didaktische Relevanz, da er die Lernenden befähigt, komplexe Situationen nicht als Aufgaben mit einer richtigen Lösung, sondern als offene Systeme mit vielen möglichen Interventionen zu begreifen.
Diese Haltung korrespondiert mit den Leitideen des OECD Learning Compass 2030, der Bildung als Balance zwischen Wissen, Fähigkeiten, Haltungen und Werten beschreibt. Die Lernenden sollen befähigt werden, nicht nur Wissen zu reproduzieren, sondern sich in komplexen, unsicheren und sich wandelnden Kontexten orientieren zu können. MINDT unterstützt dieses Ziel, indem es kognitive, kreative und soziale Dimensionen des Lernens integriert. Der Fokus verschiebt sich von der Vermittlung einzelner Fachkompetenzen hin zur Entwicklung von metakognitiven und transversalen Fähigkeiten: Problemlösung, systemisches Denken, Empathie, Kommunikation, Kooperation und Selbstwirksamkeit.
Im Hochschulkontext manifestiert sich MINDT in neuen Lernarchitekturen, die nicht mehr zwischen „technischer“ und „kreativer“ Ausbildung unterscheiden. Stattdessen werden interdisziplinäre Räume geschaffen, in denen Studierende experimentell arbeiten, reflektieren und gestalten. Das Creative Technologies Lab der FH Münster stellt ein Beispiel für eine solche Umgebung dar. Es verbindet ingenieurwissenschaftliche, informatische und gestalterische Perspektiven in einem Labor, das zugleich Werkstatt, Studio und Forschungsumgebung ist. Studierende und Forschende entwickeln dort interaktive Systeme, digitale Artefakte und physische Installationen. Die Projekte entstehen in Teams, die unterschiedliche Kompetenzen vereinen, und führen zu Ergebnissen, die technische Präzision mit ästhetischer Erfahrung und gesellschaftlicher Relevanz verbinden. MINDT wird in diesem Kontext nicht als didaktisches Etikett, sondern als Praxisform verstanden, die sich in der täglichen Arbeit manifestiert: im gemeinsamen Denken, im iterativen Prototyping, in der kritischen Reflexion technologischer Entwicklungen.
Design erfüllt in MINDT eine doppelte Funktion. Einerseits erweitert es den methodischen Werkzeugkasten der MINT-Disziplinen, indem es visuelle, narrative und haptische Formen des Erkenntnisgewinns einführt. Andererseits fungiert es als kultureller Übersetzer zwischen wissenschaftlicher Abstraktion und gesellschaftlicher Erfahrung. Wo MINT auf messbare Daten, Formeln und Modelle fokussiert, erweitert MINDT den Horizont um Bedeutung, Kontext und Wirkung. Technische Systeme werden nicht nur auf Effizienz, sondern auf Sinnhaftigkeit hin befragt. Das gestalterische Denken („Design Thinking“) stellt sicher, dass technische Innovation nicht losgelöst von menschlichen Bedürfnissen, ethischen Fragen und kulturellen Kontexten erfolgt. Dieser Human-Factor ist entscheidend, wenn Technologien gesellschaftliche Akzeptanz und langfristige Nachhaltigkeit erreichen sollen.
In der pädagogischen Praxis führt MINDT zu einer veränderten Rolle der Lehrenden. Dozierende werden zu Facilitators, Mentoren und Mitforschenden, die Lernprozesse moderieren, statt Inhalte linear zu vermitteln. Studierende übernehmen Verantwortung für ihren Lernweg, dokumentieren Experimente und reflektieren Ergebnisse. Lernen wird zu einem zyklischen Prozess von Beobachtung, Hypothese, Gestaltung, Test und Reflexion. Diese Struktur entspricht sowohl wissenschaftlichen als auch kreativen Methoden – sie verbindet Laborlogik mit Studio-Kultur. In diesem hybriden Raum entstehen neue Formen des forschenden Lernens, die sowohl auf empirische Begründung als auch auf imaginative Exploration setzen.
Die Transformation von MINT zu MINDT ist dabei nicht nur eine curriculare Entscheidung, sondern Ausdruck eines kulturellen Paradigmenwechsels. Technologische Entwicklungen wie Künstliche Intelligenz, Robotik, synthetische Materialien oder Biotechnologie verändern die gesellschaftliche Umwelt so tiefgreifend, dass herkömmliche Bildungskonzepte nicht mehr ausreichen, um Orientierung zu geben. MINDT reagiert darauf, indem es den Menschen wieder in den Mittelpunkt technologischer Entwicklung rückt. Es fragt nicht nur, was möglich ist, sondern was wünschenswert ist. Bildung wird damit zu einem ethischen Projekt, das Verantwortung, Reflexion und Gestaltung verbindet.
In diesem Zusammenhang wird auch die Verbindung zu Konzepten wie A Whole New Engineer von David E. Goldberg und Mark Somerville deutlich. Diese Publikation fordert eine ganzheitliche Reform der Ingenieurausbildung, die emotionales, reflektierendes und kollaboratives Lernen betont. Die Autoren argumentieren, dass Exzellenz im Ingenieurwesen nicht allein durch technische Kompetenz, sondern durch Empathie, Selbstwirksamkeit und die Fähigkeit zur kreativen Kooperation entsteht. Ihre Vision eines „Big E“, der Bildung als Transformation versteht, deckt sich in wesentlichen Punkten mit MINDT. Beide Konzepte verschieben den Fokus von der Wissensvermittlung zur Persönlichkeitsbildung, von Disziplinlogik zu interdisziplinärem Denken, von Kontrolle zu Vertrauen.
Ein weiterer zentraler Aspekt von MINDT ist die Verbindung von Nachhaltigkeit und Innovation. Die Integration des „D“ ermöglicht, ökologische und soziale Fragestellungen nicht als Randthemen, sondern als Ausgangspunkt technischer Entwicklung zu begreifen. Designprozesse, die Lebenszyklen, Materialkreisläufe oder Nutzerverhalten berücksichtigen, können technologische Effizienz mit ökologischer Verantwortung verbinden. Die UN-Sustainable Development Goals (SDGs) bieten hier einen normativen Rahmen, innerhalb dessen MINDT-basierte Bildung Lernende befähigt, konkrete Beiträge zu einer nachhaltigen Transformation zu leisten. Durch das Denken in Szenarien, Prototypen und iterativen Schleifen wird Nachhaltigkeit nicht als theoretisches Ziel, sondern als gestalterische Praxis erfahrbar.
Die methodische Struktur von MINDT kann über mehrere Ebenen beschrieben werden. Auf der kognitiven Ebene verbindet sie analytisches und synthetisches Denken. Auf der sozialen Ebene fördert sie kollaborative, interdisziplinäre Arbeitsformen. Auf der reflexiven Ebene regt sie dazu an, die eigenen Annahmen, Werte und Gestaltungsentscheidungen kritisch zu hinterfragen. Und auf der materiellen Ebene führt sie zu greifbaren Artefakten – Modelle, Simulationen, Installationen –, die Wissen sichtbar und überprüfbar machen. Diese vier Ebenen bilden zusammen einen iterativen Lernzyklus, der Theorie und Praxis untrennbar miteinander verbindet.
Im Kontext der Hochschulentwicklung stellt sich die Frage, wie MINDT institutionell verankert werden kann. Die Herausforderung besteht darin, Curricula zu schaffen, die Offenheit zulassen, ohne Beliebigkeit zu riskieren. Module müssen so konzipiert werden, dass sie sowohl fachliche Tiefe als auch interdisziplinäre Anschlussfähigkeit bieten. Prüfungsformen müssen prozessorientierte Leistungen anerkennen, etwa Portfolios, Prototypen oder Reflexionsberichte. Lehrende müssen befähigt werden, Studierende nicht nur zu bewerten, sondern in Entwicklungsprozessen zu begleiten. Die Einführung des Studiengangs Creative Technologies an der FH Münster kann hier als Fallbeispiel dienen: Er integriert MINDT nicht als Add-on, sondern als strukturelles Leitprinzip. Theorie, Entwurf und Realisation werden nicht getrennt, sondern in Projekten verknüpft, die reale Probleme mit technologischen und gestalterischen Mitteln bearbeiten.
Gesellschaftlich betrachtet öffnet MINDT den Diskurs über die Rolle von Technologie im Alltag. Technologien werden nicht länger als neutrale Werkzeuge, sondern als kulturelle Akteure verstanden, die soziale Praktiken, Wahrnehmungen und Werte beeinflussen. Bildung, die dies reflektiert, befähigt zukünftige Ingenieurinnen, Informatiker und Designer, Technologien nicht nur zu entwickeln, sondern auch kritisch zu interpretieren. Dieser Aspekt ist besonders relevant im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz, in dem algorithmische Entscheidungen zunehmend Lebensbereiche prägen. MINDT ermöglicht hier eine doppelte Kompetenz: das Verstehen der technologischen Grundlagen und das Bewerten ihrer gesellschaftlichen Implikationen.
Darüber hinaus adressiert MINDT die Frage nach Sinn und Identität in einer digitalisierten Welt. Während MINT-Bildung häufig auf instrumentelle Problemlösung fokussiert, öffnet MINDT den Raum für Reflexion über den Zweck menschlicher Gestaltung. Studierende werden ermutigt, eigene Perspektiven auf Fortschritt, Verantwortung und Zukunft zu entwickeln. Diese Dimension schließt an philosophische und kulturwissenschaftliche Diskurse an, die Bildung als Form der Welt- und Selbsterschließung verstehen. MINDT ist insofern nicht nur eine pädagogische Methode, sondern eine Haltung: ein bewusstes, reflektiertes und verantwortungsvolles Handeln in technologisch vermittelten Lebenswelten.
Die Umsetzung solcher Bildungsziele erfordert institutionelle und kulturelle Veränderungen. Hochschulen müssen ihre Strukturen öffnen, Fachgrenzen durchlässiger machen und neue Formen der Kollaboration etablieren. Labore, Maker-Spaces und Studios werden zu Lernorten, an denen Wissen nicht vermittelt, sondern erzeugt wird. Interdisziplinäre Teams ersetzen Einzelarbeit, Prozesse der Co-Creation und des Peer-Learnings treten an die Stelle traditioneller Vorlesungsformate. Dies verlangt nach neuen Bewertungsmaßstäben, nach Anreizsystemen für interdisziplinäre Lehrentwicklung und nach einer veränderten Auffassung von akademischer Exzellenz.
Trotz seiner integrativen Potenziale steht MINDT auch vor Herausforderungen. Die Balance zwischen fachlicher Tiefe und interdisziplinärer Breite ist schwer zu halten. Studierende können Gefahr laufen, oberflächliche Generalisten zu werden, wenn nicht klare Kompetenzprofile definiert sind. Ebenso kann die Offenheit des Ansatzes institutionell auf Widerstand stoßen, wenn traditionelle Disziplinlogiken und Ressourcenzuteilungen beibehalten werden. MINDT bedarf daher klarer Strukturen, die Interdisziplinarität ermöglichen, ohne Beliebigkeit zu fördern. Zudem ist eine kontinuierliche Evaluation erforderlich, um Wirksamkeit und Qualität sicherzustellen.
Langfristig bietet MINDT eine Chance, Bildung wieder als gesellschaftliches Gestaltungsprojekt zu denken. Die Verbindung von Wissenschaft, Technik und Design schafft die Möglichkeit, Technologien als kulturelle Ausdrucksformen zu verstehen, die Weltbeziehungen neu ordnen. Diese Perspektive schließt an die Idee des „Design as Inquiry“ an – Design als Forschungsmodus, der Erkenntnis durch Handeln erzeugt. MINDT macht damit sichtbar, dass Wissen nicht nur im Kopf, sondern auch in der materiellen und sozialen Welt entsteht.
Im globalen Kontext positioniert sich MINDT an der Schnittstelle zwischen Nord und Süd, Industrie und Gesellschaft, Hightech und Handwerk. Es ermöglicht den Dialog zwischen unterschiedlichen Wissenssystemen und Kulturen, indem es Gestaltung als universelle, aber kontextabhängige Praxis versteht. In diesem Sinn kann MINDT zur internationalen Verständigung beitragen: Technologien werden nicht mehr nur exportiert, sondern gemeinsam mit lokalen Akteuren entworfen, getestet und angepasst.
Abschließend lässt sich sagen, dass MINDT mehr als eine pädagogische Mode ist. Es ist ein Rahmen, der Bildung, Forschung und gesellschaftliche Transformation miteinander verschränkt. Indem es das Denken, Machen und Gestalten in einem kohärenten Modell vereint, schafft es die Voraussetzung für verantwortungsvolle Innovation. Es fordert dazu auf, Wissen nicht nur zu akkumulieren, sondern anzuwenden, zu reflektieren und zu teilen. Es verbindet Kopf, Hand und Herz – und macht damit sichtbar, dass wahre Bildung immer interdisziplinär, reflexiv und humanistisch ist.